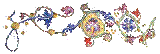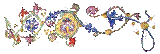|
Willkommen auf der Homepage der Autorin Isabell Pfeiffer !
|
||||||||||
|
Der Posaunenchor Er erwachte wie immer in dieser
Jahreszeit noch vor dem Morgengrauen, und sein erster Gedanke, wie an jedem
Morgen in diesen letzten Monaten, ging zurück an sie. Noch hatte er den
Faden nicht verloren, die Stunden, die seitdem vergangen waren, hielt sich
daran fest. Gut ein halbes Jahr war Maria jetzt tot, 193 Tage, 193
Nächte. Nie hätte er gedacht, dass er derjenige sein würde,
der einmal übrigblieb, wo sie doch sechs Jahre jünger gewesen war
als er und immer so gesund. „Herzinfarkt“, hatte ihm der Hausarzt
voller Mitgefühl erklärt und dabei seine zitternde Hand gehalten. „Es
ist ganz schnell gegangen. Glauben Sie mir, sie wird kaum etwas davon
gespürt haben.“ Dass ausgerechnet ihr Herz, ihr großes Herz,
sie im Stich gelassen hatte, erschien ihm widersinnig, und in seine Trauer
mischte sich manchmal ein Gefühl der Empörung, dass sie ihn einfach
so allein gelassen hatte. Aber es wäre ja nicht für lange,
tröstete er sich. Und ganz allein war er schließlich auch nicht.
Da waren die Kinder, zu denen er nach langem Sträuben vor sechs Wochen
umgezogen war, die Enkel. Nach langem Sträuben, ja.
Denn eigentlich hatte er zu Hause bleiben wollen, in der kleinen Stadt im
Ruhrgebiet, wo er bis auf wenige Kriegsjahre sein ganzes Leben verbracht
hatte; wo seine ersten Erinnerungen wohnten und seine letzten, die
schönsten und die schrecklichsten. Aber irgendwann hatte er gemerkt,
dass es einfach nicht mehr ging. Die Wohnung war zu groß für ihn
allein, und das Einkaufen und Saubermachen fiel ihm so furchtbar schwer mit
seiner Arthrose, besonders jetzt im Winter, auch wenn die Nachbarin ihm so
Manches abnahm. Und die Kinder hatten so gedrängt, dass er ihnen
schließlich nichts mehr entgegensetzen konnte. Natürlich, sie
machten sich Sorgen um ihn, sie hatten doch das große Haus in
Süddeutschland, und er bräuchte sich um nichts mehr zu kümmern
und wäre nicht mehr allein. Eine schlechte Zeit zum Umziehen, hatte er
sich noch gedacht, wenn der Herbst zu Ende geht und die Tage so furchtbar
kurz sind und die Natur so traurig. Aber sie hatten ihm ein schönes
Zimmer gegeben, mit Blick nach Osten, so dass die Morgensonne, wenn sie denn
irgendwann aufging, zu ihm hereinschien, wie er es immer geliebt hatte. Und
nur ein paar Hundert Meter entfernt war schon der Waldrand, an dem er abends
die Rehe beobachten konnte, die sich auf der Suche nach Futter auf die
große Streuobstwiese hinauswagten. Nur manchmal wünschte er sich,
er würde einmal wieder die Frachtschiffe nachts auf dem Rhein tuten
hören oder das Aufflammen des winterlichen Abendhimmels sehen, wenn sie
bei Thyssen den Abstich machten. Sein Blick blieb an dem
Feldstecher hängen, der auf dem Nachtschränkchen stand. „Ein
richtiges Zeiss-Gerät, damit du die Rehe besser beobachten
kannst“, hatte sein Sohn stolz gesagt, als er ihn ausgepackt hatte,
gestern, an seinem ersten Heiligabend seit sechsundvierzig Jahren ohne sie.
Insgeheim hatte er sich gefürchtet vor diesem Tag, der dann doch so ohne
große Erschütterung vergangen war – vielleicht, weil sie
Weihnachten immer zu Hause verbracht hatten, nie hier bei den Kindern.
„Lass den Kindern mal ihr eigenes Fest“, hatte Maria immer
gesagt. „Wir machen es uns hier gemütlich, wir zwei.“
Vorsichtig schwang er die Beine aus dem Bett und griff nach seinem
Morgenmantel. Es wurde langsam hell; er würde das Fenster öffnen
und das Glas ausprobieren. Oben, an der kleinen Straße
am Waldrand, entdeckte er eine unerwartete Bewegung, und er stutzte und
stellte das Fernglas nach. Dort standen mehrere Autos, aus denen gut ein
Dutzend Leute geschäftig irgendetwas ausluden. Sie liefen hin und her,
gestikulierten, hantierten mit großen Kästen. Verständnislos
zuerst beobachtete er dieses Treiben, bis ein vereinzelter Sonnenstrahl es
plötzlich golden aufblinken ließ von poliertem Metall, von
Trompeten, Hörnern, Posaunen. Und schon stellten die Leute, Männer
wohl hauptsächlich, sich im Halbkreis auf und setzten ihre Instrumente
an. „Wachet auf, ruft uns die Stimme ...“ Es war dieses Lied, was
sie da spielten am Weihnachtsmorgen, das Lied, das er selbst so oft gespielt
hatte! Sein altes Herz begann wild zu klopfen, und er wartete auf die Stelle,
wo sich die Oberstimme löste, diese Oberstimme, die er selbst immer
übernommen hatte mit seiner Posaune, er selbst oder der kleine Stinnes,
der jetzt schon lange unter der Erde war. „Pass bloß auf, Jung,
du mit deiner Trompete von Jericho“, hörte er seinen Vater noch,
wie er nicht ohne Stolz spottete, wenn der halbwüchsige Sohn damals in
der Küche geübt hatte. „Dass du uns die Anrichte nicht
umschmeißt! Hörste nicht, wie die Gläser schon
klimpern?“ Der Vater, der am Palmsonntag die geweihten Zweige dem
obligaten Führerbildnis an der Wand hinters Ohr steckte und später
aus Russland nicht zurückgekommen war, während er, Friedrich
Schmitt der Jüngere, in der Christmette die Oberstimme spielte ... Das alte Instrument hatte den
Krieg nicht überstanden, wie so vieles. Aber das neue, das mittlerweile
eigentlich auch schon alt war und das er jahrelang nicht mehr in den
Händen gehabt hatte, lag gut verpackt in seinem schwarzen Koffer hier
unten im Kleiderschrank. Und jetzt kam sie nicht, die Oberstimme, kam einfach
nicht, die ganze erste Strophe lang nicht! Aber das Lied ist ja lang, sie
werden ja wohl nicht nur die erste Strophe spielen, nicht mal hier, wo sie
alle evangelisch sind. Er setzt den Feldstecher ab, hastet zu seinem Schrank,
so schnell die alten Knie erlauben, holt die Posaune heraus, spürt ihre
vertraute Kühle in den Händen, an den Lippen. Und schon ist die
zweite Strophe halb vorbei, und immer noch fehlt die Oberstimme,
wahrscheinlich kennt keiner sie hier, wo man das Tuten der Rheinschiffe nicht
hören kann, lass sie doch auch die dritte noch spielen ... Da kommt
wirklich die dritte Stophe, und er setzt das Instrument an die zitternden
Lippen, spielt laut die vertrauten Töne ... Es dauerte ein paar Takte, bis
seine Ohren den grausigen Missklang realisierten, den er erzeugt hatte, und
bestürzt ließ er das Instrument sinken. Die Oberstimme war es doch
gewesen, wie er sie immer gespielt hatte, jahrelang gespielt hatte, er kannte
sie doch genau, jeden Ton, und trotzdem hatte es sich so furchtbar
angehört! Es musste die Tonart gewesen sein, sicher, der Posaunenchor
hier spielte nicht sein gewohntes C-Dur, wie hatte er nur so naiv sein
können, nicht an die Tonarten zu denken ... In Panik fast, mit
Tränen in den Augen, riss er den Feldstecher hoch, bereit, seine
schlimmsten Befürchtungen wahr werden zu sehen: sie würden
zusammenpacken, sie würden nicht weiterspielen, weil er, der Fremde,
ihre Harmonie gestört hatte am Weihnachtstag ... Da standen sie
umeinander geschart und berieten sich, einer schüttelte den Kopf, ein
anderer gab etwas herum, und dann stellten sie sich wieder auf, im Halbkreis
wie vorhin, und begannen erneut. Und diesmal hörte er es,
hörte es wie vor sechzig Jahren, den aufsteigenden Dreiklang, C –
E – G jetzt, schönstes, strahlendstes C-dur, Wachet auf, aber er
war ja schon wach, hellwach, und er hob die Posaune und spielte, und die
Oberstimme flog klar und triumphierend in den Winterhimmel hinauf. ©Isabell Pfeiffer |
||||||||||
|